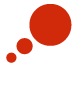Call for Papers: ZFHE 21/1
Veröffentlicht am 2025-05-14Call for Papers für die Ausgabe 21/1
Transformatives Lernen im Hochschulkontext
Herausgeber:innen: Ingrid Geier, Robert Hummer, Sandra Milz (alle PH Salzburg) & Alessandro Barberi (OVGU Magdeburg / Universität Wien)
Erscheinungstermin: März 2026
Zum Themenschwerpunkt
In einer Zeit, in der Herausforderungen wie soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung und Klimawandel zunehmend akut werden, steht die Institution Hochschule in der Verantwortung, ihren Beitrag zur Bearbeitung dieser Problemlagen zu leisten. Gerade in Krisenzeiten, in denen viele Weichen neu gestellt werden müssen, ist es entscheidend, dass Hochschulen zur selbstständigen und reflektierten Antizipation des Kommenden befähigen. Auch für die Lehrer:innenbildung gilt es, Lehrpersonen mit entsprechenden Fähigkeiten und Bereitschaften auszustatten, um Veränderungen hin zu einer nachhaltigen und gerechten Zukunft anzustoßen (zuletzt z. B. Ammerer et al., 2024).
Herausforderungen der dargelegten Art können konzeptionell unter dem Begriff der epochaltypischen Schlüsselprobleme gefasst werden (Klafki, 1993; Novy et al., 2020). Wenn es darum geht, diese Herausforderungen im Rahmen der Institution Hochschule einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung zu unterziehen und dadurch transformierbar zu machen, kommt dem Konzept des Transformativen Lernens (TL) eine Schlüsselrolle zu (z. B. Singer-Brodowski, 2016). Durch TL kann – so der Anspruch – ein pädagogischer Beitrag zu einer sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft geschaffen werden (Eicker et al., 2020), die ein gutes Leben für alle (Wintersteiner, 2021) anstrebt.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass TL längst zu einem akademischen Modewort geworden ist (EAEA, 2022), dem häufig unterschiedliche Verständnisse zugrunde liegen. Eine der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Konzeptionen stellt jene von Mezirow (1997, 2000, 2003) dar. TL orientiert sich nach Mezirow in erster Linie an individuellen Bedeutungsperspektiven und führt dazu, grundlegende Denkmuster, Werte und Perspektiven zu überdenken und zu verändern. In daran anknüpfenden Diskursen wird TL z. B. als Chance begriffen, soziale und ökologische Probleme zu lösen, indem mentale Strukturen über ein aktives Loslassen und Verlernen zu nachhaltigen Verhaltensweisen führen können (O’Sullivan, 2002). Diese Art zu Lernen „asks us to continuously reflect on […] our assumptions, values, and ways of seeing the world“ (Chaves & Wals, 2018, S. 105) und zielt darauf ab, durch aktives Tun eine Veränderung der „sozialisierten Sichtweisen und eingeschliffenen Routinen“ (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2013, S. 229) zu bewirken. Zeitgleich stellt sich beispielsweise im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) die Frage, wie mit damit verbundenen normativen Ansprüchen in Lehr-Lernprozessen professionell umgegangen werden kann (Rieckmann, 2021).
Wie z. B. die jüngste Debatte über den Whole University Approach (Wals, 2024) deutlich macht, ist TL als Thema an unterschiedlichen Hochschulstandorten angekommen (z. B. die Initiative „Haus der Transformation“ an der HTW Berlin). Umso wichtiger scheint eine diskursive Verständigung über Begriffsverständnisse, Zieldimensionen, Wirkungspotenziale, Konzepte, Projekte und Erfahrungen – auch unter Berücksichtigung der Frage, was sich daraus für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen ableiten lässt.
An diesem Punkt setzt der vorliegende Call für das ZFHE-Themenheft an. Dieses Themenheft soll Potenziale für Transformatives Lernen im Hochschulkontext identifizieren, Gelingensbedingungen ausloten und Handlungsstrategien zur Diskussion stellen. Hierbei können Fragen aus allen Disziplinen aufgegriffen werden, sofern sie eine Relevanz für die oben formulierte Themenstellung aufweisen. Dies könnten – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – z. B. sein:
- Wie gestaltet sich der aktuelle Diskurs über Transformatives Lernen (TL) im Allgemeinen und in Hinblick auf die Hochschule im Besonderen? Wie kann TL theoretisch-konzeptionell gefasst werden? Welche Ansätze lassen sich in diesem Zusammenhang identifizieren? In welchem Verhältnis stehen bestehende Ansätze aus Bereichen wie z. B. BNE, Demokratiebildung, Active Citizenship Education oder Globales Lernen zu TL?
- Wie sind die Gelingensbedingungen von TL innerhalb bestehender Bildungsstrukturen einzuschätzen? Wo liegen hier im Besonderen die Handlungsspielräume für die Institution Hochschule?
- Wie lässt sich Lehrer:innenprofessionalität im Kontext von TL fassen und systematisieren? Welche Konkretisierungen (z. B. im Bereich verschiedener Wissensdimensionen oder anderer relevanter Aspekte von professioneller Kompetenz) sind erforderlich, um transformative Lehr-Lernprozesse professionell planen, strukturieren und umsetzen zu können? Welche Faktoren können als günstige oder ungünstige Dispositionen für Lehrer:innenprofessionalität im Kontext von TL erachtet werden? Was lässt sich aus dem Konzept des TL für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen ableiten?
- Welche Gelingensbedingungen (z. B. Rahmenbedingungen, unterstützende Faktoren, Handlungsprinzipien) können bei der Umsetzung von TL auf Hochschulebene identifiziert werden? Welche (konkreten) Lehr-Lern-Methoden und didaktischen Ansätze weisen im Kontext von TL besonders großes Wirksamkeitspotenzial auf? Wie sehen Good- oder Next-Practice-Beispiele aus?
Literatur
Ammerer, H., Anglmayer-Geelhaar, M., Hummer, R., & Oppolzer, M. (Hrsg.). (2024). Utopien im Unterricht. Theoretische Verortungen – Fächerperspektiven – praktische Beispiele. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung: Bd. 14. Waxmann.
Chaves, M., & Wals, A. (2018). Chapter 5. The Nature of Transformative Learning for Social-Ecological Sustainability. In M. Krasny (Ed.), Grassroots to Global: Broader Impacts of Civic Ecology (pp. 105–123). Cornell University Press.
https://doi.org/10.7591/9781501714993-008
European Association for the Education of Adults (EAEA). (2022). Transformative learning and values: Background paper. https://eaea.org/wp-content/uploads/2022/12/EAEA-Background-paper_Transformative-Learning-and-Values-2022.pdf
Eicker, J., Eis, A., Holfelder, A.-K., Jacobs, S., Yume, S., & Konzeptwerk Neue Ökonomie (Hrsg.). (2020). Bildung Macht Zukunft. Lernen für die sozial-ökologische Transformation?. Wochenschau.
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (o. D.). Haus der Transformation. https://projekte.htw-berlin.de/transfer/haus-der-transformation/
Klafki, W. (1993). Allgemeinbildung heute – Grundzüge internationaler Erziehung. Pädagogisches Forum, 1(1), 21–28.
Mezirow, J. (1997). Transformative Erwachsenenbildung. Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung: Bd. 10. Schneider.
Mezirow, J. (Hrsg.). (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. Jossey-Bass.
Mezirow, J. (2003). Transformative Learning as Discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58–63.
Novy, A., Bärnthaler, R., & Heimerl, V. (2020). Zukunftsfähiges Wirtschaften. Beltz Juventa.
O’Sullivan, E. (2002). The Project and Vision of Transformative Education. In E. O’Sullivan, A. Morrell & M. A. O’Connor (Eds.), Expanding the Boundaries of Transformative Learning (pp. 1–12). Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-63550-4_1
Rieckmann, M. (2021). Reflexion einer Bildung für nachhaltige Entwicklung aus bildungstheoretischer Perspektive. Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, 44(2), 5–16. https://doi.org/10.20377/rpb-153
Schneidewind, U., & Singer-Brodowski, M. (2013). Transformative Wissenschaft: Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem. Metropolis.
Singer-Brodowski, M. (2016). Transformative Bildung durch transformatives Lernen. Zur Notwendigkeit der erziehungswissenschaftlichen Fundierung einer neuen Idee. Waxmann.
Wals, A. (2024, 24. Oktober). A whole university approach to creating hopeful futures in times of urgency. [Online-Vortrag]. Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Symposium Transformative Bildung im Hochschulkontext: Potenziale – Gelingensbedingungen – Handlungsstrategien, Salzburg, Österreich.
Wintersteiner, W. (2021). Die Welt neu denken lernen – Plädoyer für eine planetare Politik: Lehren aus Corona und anderen existentiellen Krisen. transcript.
Hinweise zur Zeitschrift
Die ZFHE ist ein referiertes Online-Journal für wissenschaftliche Beiträge mit praktischer Relevanz zu aktuellen Fragen der Hochschulentwicklung. Der Fokus liegt dabei auf den didaktischen, strukturellen und kulturellen Entwicklungen in Lehre und Studium. Dabei werden in besonderer Weise Themen aufgenommen, die als innovativ und hinsichtlich ihrer Gestaltungsoptionen noch als offen zu bezeichnen sind.
Die ZFHE wird von einem Konsortium von europäischen Wissenschaftler:innen herausgegeben. Weitere Informationen: https://www.zfhe.at.
Informationen zur Einreichung
Beiträge können in drei unterschiedlichen Formaten in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden:
Ein Forschungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- behandelt eine systematische Frage in trans-, inter- oder fachdisziplinären Zusammenhängen;
- hat eine Forschungslücke als Ausgangspunkt;
- weist eine umfangreiche Einbettung in den wissenschaftlichen Diskurs auf;
- verfügt über eine robuste methodische Herangehensweise;
- beinhaltet eine Reflexion der eigenen Arbeit;
- stellt das forschungsmethodische Vorgehen dar;
- setzt eine Methode ein, die sich sehr gut eignet, um die Forschungsfrage zu beantworten;
- stellt den wissenschaftlichen Diskurs reflektiert dar;
- bietet einen deutlich erkennbaren Mehrwert bzw. Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage respektive zur Forschungsdiskussion;
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt) und
- Literatur- und Autorenangaben.
Ein Forschungsgeleiteter Entwicklungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- bietet eine Hochschulentwicklungsperspektive mit fundierter Forschungsbasierung;
- erörtert und differenziert ein systematisches Problem der Lehrentwicklung;
- ist ein wissenschaftlich reflektierter „Institutional Research“-Beitrag;
- wird durch einen Literaturüberblick unterstützt;
- erkennbare Adressierung der Wissenschafts-Praxis-Kommunikation und/oder der Verbindung zwischen den beiden Polen „Forschung und Entwicklung“;
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt;
- Literatur- und Autorenangaben.
Ein Entwicklungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- behandelt ein konkretes Problem der Hochschulentwicklung in der (eigenen)Hochschule;
- Praxisdesiderat;
- ist in die wissenschaftliche Diskussion und Literatur eingebettet (jedoch ohne den Anspruch, einen Überblick über die Literatur zu erhalten);
- bietet Anregungen zur Lehr- und Hochschulentwicklung ggf. mit Handlungsempfehlungen;
- folgt einer systematischen und transparenten Darstellung (z. B. keine unverständlichen Hinweise auf Spezifika und Details in einem Praxisfeld);
- arbeitet generalisierbare Aspekte und Faktoren im Sinne einer Theoriebildung heraus;
- ersichtliche Transferüberlegungen;
- Forschungsdesiderate sind benannt;
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt;
- Literatur- und Autorenangaben.
Zeitplan
20. August 2025 – Deadline zur Einreichung des vollständigen Beitrags: Ihre Beiträge laden Sie im ZFHE-Journalsystem (https://www.zfhe.at) unter der entsprechenden Rubrik (Forschungsbeitrag, Forschungsgeleiteter Entwicklungsbeitrag, Entwicklungsbeitrag) der Ausgabe 21/1 in anonymisierter Form hoch; hierzu müssen Sie sich zuvor als „Autor:in“ im System registrieren.
September/Oktober 2025 – Rückmeldung/Reviews: Sämtliche Beiträge werden in einem Double-blind-Verfahren beurteilt (s. u.).
Dezember 2025 – Deadline Überarbeitung: Gegebenenfalls können Beiträge entsprechend Kritik und Empfehlungen aus den Reviews bis zu diesem Zeitpunkt von den Autor:innen überarbeitet werden.
März 2026 – Publikation: Im März 2026 werden die finalisierten Beiträge unter https://www.zfhe.at publiziert und auch als Printpublikation erhältlich sein.
Review-Verfahren
Sämtliche eingereichten Beiträge werden in einem „double-blind“ Peer-Review-Verfahren auf ihre wissenschaftliche Qualität überprüft. Die Herausgeber:innen eines Heftes schlagen die Gutachter:innen für den jeweiligen Themenschwerpunkt vor und weisen die einzelnen Beiträge den Gutachter:innen zu; sie entscheiden auch über die Annahme der Beiträge. Die Auswahl der Gutachter:innen und der Begutachtungsprozess werden bei jedem Themenheft jeweils von einem Mitglied des Editorial Boards begleitet.
Formatierung und Einreichung
Um bei der Formatierung der Beiträge wertvolle Zeit zu sparen, möchten wir alle Autor:innen, von Beginn an bitten, mit der Formatvorlage zu arbeiten, die auf der Homepage der ZFHE heruntergeladen werden kann:
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_de.docx
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_en.docx
Die Texte müssen bearbeitbar sein und z. B. in den Formaten Microsoft Word (.doc), Office Open XML (.docx), Open Document Text (.odt) oder als Plain Text (.txt) vorliegen; bitte keine PDF-Dateien einreichen. Die Beiträge werden zunächst in anonymisierter Fassung benötigt, um das Double-blind-Reviewverfahren zu gewährleisten. Bitte entfernen Sie hierzu sämtliche Hinweise auf die Autor:innen aus dem Dokument (auch in den Dokumenteigenschaften!). Nach positivem Reviewergebnis werden diese Angaben wieder eingefügt.
Noch Fragen?
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an
Dr. Ingrid Geier (ingrid.geier@phsalzburg.at),
MMag. Robert Hummer (robert.hummer@phsalzburg.at),
Dr. Sandra Milz (sandra.milz@phsalzburg.at)
und
Dr. Alessandro Barberi (office@zfhe.at)
Wir freuen uns auf Ihre Einreichung!
Ingrid Geier, Robert Hummer, Sandra Milz und Alessandro Barberi (Hg.)
______________________________________________________________________________
Call for Papers for issue 21/1 (English version)
Special Issue: Transformative Learning in Higher Education
Editors: Ingrid Geier, Robert Hummer, Sandra Milz (Salzburg University of Education)
Publication date: March 2026
Main Topic
Inequality, environmental degradation, and climate change are increasingly urgent challenges, and institutions of higher education bear a particular responsibility to help solve these pressing issues. Especially in times of crisis—when new paths must be charted—universities must empower students to critically and independently anticipate future developments. In teacher education, this means equipping future educators with the skills, mindsets, and readiness to initiate change toward a sustainable and just future (see, most recently, Ammerer et al., 2024).
Such challenges may be conceptually framed as epoch-typical key problems (Klafki, 1993; Novy et al., 2020). The concept of transformative learning (TL) is central to critically and reflectively engaging with these challenges within higher education and thereby enabling transformative responses (e.g., Singer-Brodowski, 2016). TL is considered a means of contributing to the socio-ecological transformation of society—one that seeks to promote a “good life” for all (Eicker et al., 2020; Wintersteiner, 2021).
At the same time, it must be acknowledged that transformative learning has become something of an academic buzzword (EAEA, 2022), often used with varying interpretations. One of the most influential theoretical frameworks is that of Jack Mezirow (1997, 2000, 2003), who conceptualizes TL as a process primarily focused on the transformation of individual meaning perspectives. In this view, TL involves a critical reassessment and reconfiguration of fundamental assumptions, values, and worldviews.
In related discussions, TL is also seen as a pathway for addressing social and ecological issues—by intentionally “letting go” of outdated mental models and engaging in processes of unlearning (O'Sullivan, 2002). As Chaves and Wals (2018, p. 105) put it, this type of learning “asks us to continuously reflect on [...] our assumptions, values, and ways of seeing the world.” It seeks to shift deeply socialized perspectives and entrenched routines through critical reflection and active engagement (Schneidewind & Singer-Brodowski, 2013, p. 229). Within the framework of Education for Sustainable Development (ESD), this raises important questions about how such normative demands can be professionally and productively addressed within teaching and learning processes (Rieckmann, 2021).
As the recent debate on the Whole Institution Approach (Wals, 2024) demonstrates, transformative learning (TL) has become an established topic at numerous higher education institutions—such as the “House of Transformation” initiative at HTW Berlin. This growing visibility underscores the need for a shared discourse that clarifies key terms, goals, expected impacts, theoretical frameworks, practical projects, and lived experiences—particularly with regard to what implications can be drawn for initial teacher education, as well as continuing and in-service professional development.
This is where the present call for contributions to the ZFHE special issue comes in. The goal of this issue is to illuminate the potential of transformative learning within higher education settings, examine the conditions that support its successful implementation, and present actionable strategies for reflection and further discussion. Contributions from all disciplines are welcome, provided they engage meaningfully with the overarching theme. Without aiming to be exhaustive, possible guiding questions include:
- What is the current state of discourse on transformative learning (TL), both in general and specifically within higher education?
How can TL be theoretically conceptualized? What diverse approaches exist, and how do they relate to one another? How can concepts from adjacent fields—such as Education for Sustainable Development (ESD), democratic education, active citizenship education, or global learning—be connected to or distinguished from TL? - What are the structural and institutional conditions that support or hinder TL in higher education?
In particular, what room for maneuvering exists within the university as an institution? How can teacher professionalism be defined and systematized within the context of TL? What forms of concretization—e.g., in terms of types of knowledge or relevant aspects of professional competence—are necessary to effectively design, facilitate, and evaluate transformative teaching and learning processes? Which factors serve as enablers or barriers to professional practice in the context of TL? What implications can be drawn for the initial and continuing education of teachers? - What Conditions for success—such as structural frameworks, enabling conditions, or guiding principles—can be identified for the implementation of TL at the university level?
Which specific teaching and learning methods, or didactic models, have proven particularly effective for fostering TL? What do good practice—or next practice—examples look like?
References
Ammerer, H., Anglmayer-Geelhaar, M., Hummer, R., & Oppolzer, M. (Hrsg.). (2024). Utopien im Unterricht. Theoretische Verortungen – Fächerperspektiven – praktische Beispiele. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung: Bd. 14. Waxmann.
Chaves, M., & Wals, A. (2018). Chapter 5. The Nature of Transformative Learning for Social-Ecological Sustainability. In M. Krasny (Ed.), Grassroots to Global: Broader Impacts of Civic Ecology (pp. 105–123). Cornell University Press.
https://doi.org/10.7591/9781501714993-008
European Association for the Education of Adults (EAEA). (2022). Transformative learning and values: Background paper. https://eaea.org/wp-content/uploads/2022/12/EAEA-Background-paper_Transformative-Learning-and-Values-2022.pdf
Eicker, J., Eis, A., Holfelder, A.-K., Jacobs, S., Yume, S., & Konzeptwerk Neue Ökonomie (Hrsg.). (2020). Bildung Macht Zukunft. Lernen für die sozial-ökologische Transformation?. Wochenschau.
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (o. D.). Haus der Transformation. https://projekte.htw-berlin.de/transfer/haus-der-transformation/
Klafki, W. (1993). Allgemeinbildung heute – Grundzüge internationaler Erziehung. Pädagogisches Forum, 1(1), 21–28.
Mezirow, J. (1997). Transformative Erwachsenenbildung. Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung: Bd. 10. Schneider.
Mezirow, J. (Hrsg.). (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. Jossey-Bass.
Mezirow, J. (2003). Transformative Learning as Discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58–63.
Novy, A., Bärnthaler, R., & Heimerl, V. (2020). Zukunftsfähiges Wirtschaften. Beltz Juventa.
O’Sullivan, E. (2002). The Project and Vision of Transformative Education. In E. O’Sullivan, A. Morrell & M. A. O’Connor (Eds.), Expanding the Boundaries of Transformative Learning (pp. 1–12). Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-63550-4_1
Rieckmann, M. (2021). Reflexion einer Bildung für nachhaltige Entwicklung aus bildungstheoretischer Perspektive. Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, 44(2), 5–16. https://doi.org/10.20377/rpb-153
Schneidewind, U., & Singer-Brodowski, M. (2013). Transformative Wissenschaft: Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem. Metropolis.
Singer-Brodowski, M. (2016). Transformative Bildung durch transformatives Lernen. Zur Notwendigkeit der erziehungswissenschaftlichen Fundierung einer neuen Idee. Waxmann.
Wals, A. (2024, 24. Oktober). A whole university approach to creating hopeful futures in times of urgency. [Online-Vortrag]. Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig. Symposium Transformative Bildung im Hochschulkontext: Potenziale – Gelingensbedingungen – Handlungsstrategien, Salzburg, Österreich.
Wintersteiner, W. (2021). Die Welt neu denken lernen – Plädoyer für eine planetare Politik: Lehren aus Corona und anderen existentiellen Krisen. transcript.
Notes on the Journal
ZFHE – Journal for Research in Higher Education is a peer-reviewed, open-access online journal that publishes scholarly articles with practical relevance to current challenges in higher education development. The journal focuses on didactic, structural, and cultural innovations in teaching and learning. It particularly welcomes contributions that address forward-looking topics with open-ended or experimental design possibilities.
ZFHE is published by a consortium of European scholars.
Further information is available at: https://www.zfhe.at
Information on Submission
Manuscripts may be submitted in either German or English and in one of the following three formats:
1. Research Contribution
A research contribution should meet the following criteria:
- Addresses a systematic question within transdisciplinary, interdisciplinary, or discipline-specific contexts;
- Begins with a clearly defined research gap;
- Is thoroughly embedded in the relevant academic discourse;
- Applies a sound methodological approach;
- Reflects on the author’s own research process;
- Clearly presents the research design and methodology;
- Utilizes methods that are well suited to answering the research question;
- Engages critically with the academic discourse;
- Offers a clear added value or contribution to the scholarly discussion;
- Adheres consistently to APA style (current edition);
Has a length of 20,000–33,000 characters (including spaces, cover page, references, and author information).
2. Research-Led Development Contribution
A research-led development contribution should meet the following criteria:
- Offers a perspective on higher education development grounded in solid research;
- Examines a clearly defined issue in teaching development;
- Represents a scientifically grounded form of institutional research;
- Includes a literature-based foundation;
- Demonstrates a clear connection between theory and practice and/or research and development;
- Adheres consistently to APA style (current edition);
- Has a length of 20,000–33,000 characters (including spaces, cover page, references, and author information).
3. Development Contribution
A development contribution should meet the following criteria:
- Addresses a specific issue related to higher education development within the contributor’s own institution;
- Responds to a practical need;
- Is embedded in relevant academic discourse, though without the expectation of a full literature review;
- Provides practical recommendations for teaching and institutional development where appropriate;
- Follows a systematic and transparent structure (e.g., avoids vague references to internal specifics);
- Identifies generalizable elements that contribute to theory-building;
- Includes clear considerations for transferability;
- Identifies research gaps;
- Adheres consistently to APA style (current edition);
- Has a length of 20,000–33,000 characters (including spaces, cover page, references, and author information).
Schedule
- August 20, 2025 – Submission deadline: Please upload your anonymized full article via the ZFHE online journal system at https://www.zfhe.at, selecting the appropriate section (Research Contribution, Research-Led Development Contribution, or Development Contribution) for issue 21/1. Prior to submission, authors must register in the system as an “Author:in.”
- September–October 2025 – Peer review process: All submissions will be evaluated through a double-blind peer review process (see below).
- December 15, 2025 – Revision deadline: If applicable, authors may revise their submissions in response to reviewer comments by this date.
- March 2026 – Publication: Finalized contributions will be published online at https://www.zfhe.at and will also be available in print.
Review Process
All submitted manuscripts undergo a double-blind peer review to assess their academic quality. The editors of the respective issue will propose reviewers for the thematic focus and assign individual contributions accordingly. Final decisions regarding acceptance are made by the editorial team. The review process is overseen by a member of the ZFHE Editorial Board to ensure quality and transparency.
Formatting and Submission Guidelines
To streamline the editing and publication process, we kindly ask all authors to use the official ZFHE formatting template from the outset. Templates are available for download here:
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_de.docx
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_en.docx
Submissions must be provided in an editable file format: Microsoft Word (.doc or .docx), Open Document Text (.odt), or Plain Text (.txt). PDF files will not be accepted.
Please ensure that your manuscript is fully anonymized before submission to maintain the integrity of the double-blind review process. This includes removing author names and affiliations from both the manuscript text and the document properties. Author details will be reinserted following acceptance.
Questions?
For questions related to content, feel free to contact the guest editors:
Dr. Ingrid Geier (ingrid.geier@phsalzburg.at),
MMag. Robert Hummer (robert.hummer@phsalzburg.at),
Dr. Sandra Milz (sandra.milz@phsalzburg.at)
and
Dr. Alessandro Barberi (office@zfhe.at)
We look forward to receiving your contribution!
Ingrid Geier, Robert Hummer, Sandra Milz and Alessandro Barberi (Eds.)