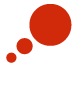Call for Papers: ZFHE 21/2
Veröffentlicht am 2025-11-05Call for Papers ZFHE 21/2
Europäische Hochschulallianzen in Aktion
Herausgeber:innen: Martin Ebner, Channa van der Brug, Elena Wilhelm
Ausgangslage
Mit der European Universities Initiative (EUI) verfolgt die Europäische Kommission seit 2019 das Ziel, transnationale Hochschulallianzen als Universitäten der Zukunft zu etablieren. Diese Allianzen sollen die Zusammenarbeit europäischer Hochschulen in Bildung, Forschung und Innovation strukturell vertiefen, die Mobilität von Studierenden und Lehrenden erleichtern sowie gemeinsame, studierendenzentrierte Curricula und Forschungsstrategien entwickeln. Gleichzeitig wird der Anspruch formuliert, die europäischen Werte und die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents zu stärken und damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration des Europäischen Hochschulraums zu leisten (Europäische Kommission, 2023).
Nach einer Analyse des European Parliamentary Research Service sind Anfang 2025 bereits 65 Allianzen in 35 Ländern mit über 570 Hochschulen und rund elf Millionen Studierenden aktiv. Diese beeindruckende Dynamik markiert nicht nur eine neue Stufe europäischer Hochschulpolitik, sondern wirft auch grundlegende Fragen auf: Wie verändern sich Governance-Strukturen, Organisationskulturen und epistemische Ordnungen, wenn Hochschulen in derart tiefgreifende transnationale Verbünde eingebunden werden? Welche Spannungen entstehen zwischen europäischen Steuerungslogiken und nationalen Autonomieansprüchen? Welche Vorstellungen von Wissenschaft, Bildung und Identität prägen das entstehende Feld Europäischer Hochschulallianzen?
Während die politische Programmatik der Europäischen Kommission auf Integration, Effizienz und Kohärenz zielt, wird in der Forschung zunehmend auf die Ambivalenzen dieser Entwicklung hingewiesen. Einerseits eröffnen sich neue Räume institutioneller Kooperation, andererseits drohen Prozesse der Homogenisierung, Unterfinanzierung, Standardisierung und Hierarchisierung, die insbesondere kleinere oder nicht-universitäre Hochschulen marginalisieren könnten (Vukasovic & Stensaker, 2018). Die EU kann somit zugleich als Experimentierfeld und als Konfliktzone verstanden werden: als Raum, in dem Fragen nach Macht, Differenz, Governance und kultureller Identität im europäischen Hochschulraum neu verhandelt werden.
Zielsetzung der Ausgabe
Die geplante Ausgabe der Zeitschrift für Hochschulentwicklung lädt dazu ein, europäische Hochschulallianzen nicht primär als politische oder administrative Programme, sondern als institutionelle, soziale und kulturelle Phänomene zu untersuchen. Im Zentrum stehen Beiträge, die die vielfältigen Dynamiken der Allianzbildung zwischen Integration und Differenz kritisch reflektieren und sowohl empirisch als auch theoretisch fundierte Perspektiven eröffnen.
Dabei sollen nicht nur organisatorische und rechtliche Herausforderungen beleuchtet, sondern auch die epistemischen, normativen und symbolischen Dimensionen dieser neuen Kooperationsformen in den Blick genommen werden. Ziel ist es, den Diskurs über europäische Hochschulzusammenarbeit um analytische, diskursive und macht-kritische Perspektiven zu erweitern – und damit einen Beitrag zu einem differenzierten Verständnis europäischer Hochschulgovernance im 21. Jahrhundert zu leisten.
Ebenso sollen auch die Perspektiven der einzelnen Hochschulen hinsichtlich ihrer Positionierung, ihrer Verantwortlichkeit und Rolle, sowie den neuen Chancen und Herausforderungen Raum gegeben werden.
Erwünscht sind insbesondere Beiträge, die Verbindungen zwischen Theorie und Praxis herstellen:
- Analysen, die das institutionelle Handeln in Allianzen in den Kontext europäischer Wissenschaftspolitik stellen.
- Fallstudien, die Einblicke in konkrete Erfahrungen, Aushandlungsprozesse oder Konflikte bieten.
- Theoretisch-konzeptionelle Arbeiten, die europäische Allianzbildung als Ausdruck tiefer liegender Transformationen von Hochschulorganisation und akademischer Kultur deuten.
Mögliche thematische Zugänge
Die Beiträge könnten unter anderem folgende Perspektiven einnehmen, sind aber nicht ausschliesslich:
- Governance und Macht: Wie werden Entscheidungs-, Steuerungs- und Verantwortlichkeitsstrukturen in europäischen Allianzen ausgehandelt? Welche neuen Formen multilateraler Steuerung entstehen im Zusammenspiel von europäischer Politik, nationaler Hochschulgesetzgebung und institutioneller Autonomie (Pinheiro et al., 2024; Maassen et al., 2023)?
- Identität und Differenz: Welche Narrative und Werte prägen die Selbstbeschreibung europäischer Allianzen? Wie wird „Europäizität“ diskursiv und organisatorisch hergestellt, und welche Formen der Exklusion oder Hierarchisierung gehen damit einher (de Boer & Huisman, 2020)?
- Strategie und Organisation: Welche neuen Rollen, Professionen und Interaktionsformen entstehen, wenn Lehre, Forschung und Verwaltung über nationale Grenzen hinweg integriert werden sollen? Wie kann die Strategie der Allianz als Hebel für die bereits existierenden Digitalisierungs- und Internationalisierungsstrategien der Partner dienen?
- Alltägliche Umsetzungspraxis: Verwaltung, Lehre- und Lernen: Welche alltäglichen Prozesse sind grundlegend für eine Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung und Lehre bzw. wie werden und wurden diese gelöst? Welche (interoperablen) Lösungen sind in Ausarbeitung oder notwendig, um den Lehrbetrieb nachhaltig zu unterstützen? Wie können Joint Programms umgesetzt und promotet werden? Wie lassen sich die alltäglichen Praktiken, Spannungen und Lernprozesse innerhalb solcher Allianzen beobachten?
Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Willkommen sind auch Beiträge, die aus kultur-, bildungs- oder sozialtheoretischer Perspektive nach den symbolischen und epistemischen Implikationen europäischer Hochschulzusammenarbeit fragen – etwa im Hinblick auf Sprache, Raum, Zugehörigkeit oder kollektive Imaginationen von Zukunft.
Literatur
Europäische Kommission (2023). European Universities Initiative – Building the universities of the future. Brussels. https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
European Commission (2025): Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, PPMI, Grumbinaitė, I., Colus, F., & Buitrago Carvajal, H., Report on the outcomes and transformational potential of the European Universities initiative, Publications Office of the European Union, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2766/32313?
De Boer, H. F., & Huisman, J. (2020). Governance Trends in European Higher Education. In G. Capano, & D. Jarvis (Eds.), Convergence and Diversity in the Governance of Higher education: Comparative Perspectives (S. 333-354). (Cambridge Studies in Comparative Public Policy). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108669429.013
Maassen, P., Stensaker, B., & Rosso, A. (2023). The European university alliances – an examination of organizational potentials and perils. Higher Education, 86(4), 953–968.
Pinheiro, R., Gänzle, S., Klenk, T., & Trondal, J. (2024). Unpacking strategic alliances in European higher education. Tertiary Education and Management, 30(1), 1–21. https://doi.org/10.1007/s11233-024-09133-6
Vukasovic, M., & Stensaker, B. (2018). University alliances in the Europe of knowledge: Positions, agendas and practices in policy processes. European Educational Research Journal, 17(3), 349–364.
European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Deloitte, EDEN, German Academic Exchange Service, Knowledge Innovation Centre (KIC), Stifterverband and SURF, An analysis of the state of interoperability across higher education systems in Europe (synthesis report) – European higher education interoperability framework, Publications Office of the European Union, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2766/556601
Hinweise zur Zeitschrift
Die ZFHE ist ein referiertes Online-Journal für wissenschaftliche Beiträge mit praktischer Relevanz zu aktuellen Fragen der Hochschulentwicklung. Der Fokus liegt dabei auf den didaktischen, strukturellen und kulturellen Entwicklungen in Lehre und Studium. Dabei werden in besonderer Weise Themen aufgenommen, die als innovativ und hinsichtlich ihrer Gestaltungsoptionen noch als offen zu bezeichnen sind.
Die ZFHE wird von einem Konsortium von europäischen Wissenschaftler:innen herausgegeben. Weitere Informationen: https://www.zfhe.at.
Informationen zur Einreichung
Beiträge können in drei unterschiedlichen Formaten in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden:
Ein Forschungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- behandelt eine systematische Frage in trans-, inter- oder fachdisziplinären Zusammenhängen;
- hat eine Forschungslücke als Ausgangspunkt;
- weist eine umfangreiche Einbettung in den wissenschaftlichen Diskurs auf;
- verfügt über eine robuste methodische Herangehensweise;
- beinhaltet eine Reflexion der eigenen Arbeit;
- stellt das forschungsmethodische Vorgehen dar;
- setzt eine Methode ein, die sich sehr gut eignet, um die Forschungsfrage zu beantworten;
- stellt den wissenschaftlichen Diskurs reflektiert dar;
- bietet einen deutlich erkennbaren Mehrwert bzw. Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage respektive zur Forschungsdiskussion;
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt; Literatur- und Autorenangaben).
Ein Forschungsgeleiteter Entwicklungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- bietet eine Hochschulentwicklungsperspektive mit fundierter Forschungsbasierung;
- erörtert und differenziert ein systematisches Problem der Lehrentwicklung
- ist ein wissenschaftlich reflektierter „Institutional Research“-Beitrag
- wird durch einen Literaturüberblick unterstützt;
- erkennbare Adressierung der Wissenschafts-Praxis-Kommunikation und/oder der Verbindung zwischen den beiden Polen „Forschung und Entwicklung“;
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt; Literatur- und Autorenangaben).
In Entwicklungsbeitrag sollte folgende Kriterien erfüllen:
- behandelt ein konkretes Problem der Hochschulentwicklung in der (eigenen)Hochschule;
- Praxisdesiderat;
- ist in die wissenschaftliche Diskussion und Literatur eingebettet (jedoch ohne den Anspruch, einen Überblick über die Literatur zu erhalten);
- bietet Anregungen zur Lehr- und Hochschulentwicklung ggf. mit Handlungsempfehlungen;
- folgt einer systematischen und transparenten Darstellung (z. B. keine unverständlichen Hinweise auf Spezifika und Details in einem Praxisfeld);
- arbeitet generalisierbare Aspekte und Faktoren im Sinne einer Theoriebildung heraus;
- ersichtliche Transferüberlegungen;
- Forschungsdesiderate sind benannt
- folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (APA-Stil, aktuelle Auflage);
- umfasst zwischen 20.000 und 33.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen sowie Deckblatt; Literatur- und Autorenangaben).
Zeitplan
15. Februar 2026 – Deadline zur Einreichung des vollständigen Beitrags: Ihre Beiträge laden Sie im ZFHE-Journalsystem (https://www.zfhe.at) unter der entsprechenden Rubrik (Forschungsbeitrag, Forschungsgeleiteter Entwicklungsbeitrag, Entwicklungsbeitrag) der Ausgabe 21/2 in anonymisierter Form hoch; hierzu müssen Sie sich zuvor als „Autor:in“ im System registrieren.
Mitte/Ende März 2026 – Rückmeldung/Reviews: Sämtliche Beiträge werden in einem Double-blind-Verfahren beurteilt (s. u.).
Mitte/Ende April 2026 – Deadline Überarbeitung: Gegebenenfalls können Beiträge entsprechend Kritik und Empfehlungen aus den Reviews bis zu diesem Zeitpunkt von den Autor:innen überarbeitet werden.
Juni 2026 – Publikation: Im Juni 2026 werden die finalisierten Beiträge unter https://www.zfhe.at publiziert und auch als Printpublikation erhältlich sein.
Review-Verfahren
Sämtliche eingereichten Beiträge werden in einem „double-blind“ Peer-Review-Verfahren auf ihre wissenschaftliche Qualität überprüft. Die Herausgeber:innen eines Heftes schlagen die Gutachter:innen für den jeweiligen Themenschwerpunkt vor und weisen die einzelnen Beiträge den Gutachter:innen zu; sie entscheiden auch über die Annahme der Beiträge. Die Auswahl der Gutachter:innen und der Begutachtungsprozess werden bei jedem Themenheft jeweils von einem Mitglied des Editorial Boards begleitet.
Formatierung und Einreichung
Um bei der Formatierung der Beiträge wertvolle Zeit zu sparen, möchten wir alle Autor:innen, von Beginn an bitten, mit der Formatvorlage zu arbeiten, die auf der Homepage der ZFHE heruntergeladen werden kann:
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_de.docx
https://www.zfhe.at/userupload/ZFHE_20-3_TEMPLATE_en.docx
Die Texte müssen bearbeitbar sein und z. B. in den Formaten Microsoft Word (.doc), Office Open XML (.docx), Open Document Text (.odt) oder als Plain Text (.txt) vorliegen; bitte keine PDF-Dateien einreichen. Die Beiträge werden zunächst in anonymisierter Fassung benötigt, um das Double-blind-Reviewverfahren zu gewährleisten. Bitte entfernen Sie hierzu sämtliche Hinweise auf die Autor:innen aus dem Dokument (auch in den Dokumenteigenschaften!). Nach positivem Reviewergebnis werden diese Angaben wieder eingefügt.
Noch Fragen?
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an
Martin Ebner (martin.ebner@tugraz.at), Channa van der Brug (channa.vanderbrug@stifterverband.de) oder Elena Wilhelm (elena.wilhelm@zhdk.ch) Bei technischen und organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an Alessandro Barberi (office@zfhe.at).
Wir freuen uns auf Ihre Einreichung!
Martin Ebner, Channa van der Brug, Elena Wilhelm und Alessandro Barberi